„Umgang mit dem Bösen“
Projekt der Fächer Philosophie und Religion im Jahrgang 12
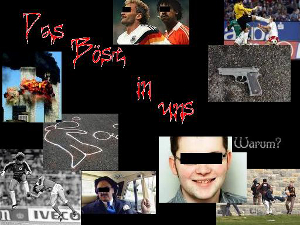
Um Raum für eine vertiefende Auseinandersetzung mit einem fächerübergreifenden Themenschwerpunkt zu geben, haben die Philosophie- und Religionslehrer des Jahrgangs 12 den Projekttag „Umgang mit dem Bösen“ geplant.
Dabei hat sich zunächst jeder Kurs andere Schwerpunkte gesetzt, wie z.B. die Diskussion und Urteilsbildung in ethischen Dilemmasituationen:
- Darf die Polizei einem Entführer mit Folter drohen und diese auch anwenden, um den Entführten zu finden?
- Dürfen Mitglieder einer Terrororganisation gefoltert werden, damit ein Attentat auf unschuldige Menschen verhindert werden kann?
- Ist es moralisch gerechtfertigt einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, wenn der Embryo nachweislich einen Gendefekt aufweist?
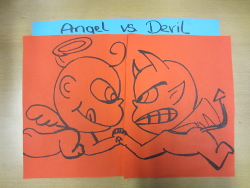
Mit der Wissenschaftsdokumentation „Täter ohne Reue“ wurde die Frage nach dem Bösen aus wissenschaftlichem Blickwinkel untersucht: Ist kriminelles Verhalten angeboren oder erlernt? Kann jeder Mensch zum Killer werden? Kann man "Das Böse" in Hirnscans sehen? Was treibt eiskalte Mörder, Triebtäter und Sadisten an? Bereits seit Jahrhunderten treibt die Wissenschaftler die Frage an, ob es eine Stelle im Körper gibt, wo man "das Böse" verorten kann. Mit Hilfe der Neurowissenschaften können heute konkrete Antworten gegeben werden: So werden bei Gewalttätern die Hirn-Regionen, die für Schmerz und Empathie zuständig sind, kaum aktiviert. Doch dieses Manko muss nicht angeboren sein, denn Umwelteinflüsse könnten das Gehirn verformen. Die Konsequenz der Wissenschaftler aus ihren Forschungsergebnissen, die eingeschränkte Schuldfähigkeit von Psychopathen und Schwerverbrechern, wurde von den Schülern sehr kontrovers und engagiert diskutiert.
Inwieweit auch jeder von uns zum Täter werden kann, war Gegenstand der Auseinandersetzung mit psychologischen Experimenten wie dem Milgram- und dem Stanford-Prison-Experiment. Dass die Ergebnisse dieser Studien immer noch aktuell sind, zeigen zum Beispiel die Misshandlungen von Bundeswehr-Rekruten. Wie kann ich mich gegen das „Böse in mir“ schützen? Eine Antwort hierauf liefert die Verantwortungsethik Sartres: Bei Sartre wird das Handeln des Einzelnen und dessen Folgen auf das Ganze zum moralischen Maßstab. Jeder Mensch ist zur Freiheit und zur Verantwortung „verurteilt“. Sartre geht soweit, dass für ihn nur derjenige wirklich lebe, welcher für sein Leben auch die Verantwortung übernimmt, und wer dies nicht tut, der existiere nur und besäße keinerlei Freiheit oder gar einen Sinn des Lebens.

Die Religionsgruppe (kath. und ev. Religionslehre) hat sich – ausgehend von Filmausschnitten Taylor Hackfords Film Im Auftrag des Teufels (1997) – zunächst an eine Begriffsbestimmung der Begriffe Teufel, Satan, Dämonen, Erbsünde, Sünde und der sieben Todsünden begeben. Zu diesen eher klassischen Definitionen kamen neuere Definitionen von Sünde hinzu, beispielsweise das Entferntsein/Getrenntsein vom Göttlichen.
Recht schnell wurde an diversen Fallbeispielen klar, dass es keine pauschale Definition von Sünde gibt. Der Kurs ordnete menschliche Handlungen nach unterschiedlichen Aspekten ein und bewertete sie insgesamt, beispielsweise nach dem Grad der Destruktivität, nach dem Maß der Bewusstheit des Täters, nach dem egoistischen Interesse des Täters. Zum Teil entstanden bei komplexen Fällen recht hitzige Diskussionen. Sehr interessant war, dass der Punkt, dass in den Menschen auch ungute Aspekte schlummern, von den Philosophen (Milgram Experiment sowie dem Stanford-Prison-Experiment) ebenfalls thematisiert wurde.
Der Projekttag endete mit einer Zusammenkunft des gesamten Jahrgangs, bei der die Schüler sich gegenseitig ihre Ergebnisse vorstellten und die Gelegenheit zum Austausch nutzten.
Ein rundum gelungener Tag – finden nicht nur die beteiligten Kollegen, Frau Nöh, Herr Weissinger und Frau Käding, sondern auch die Schüler des 12. Jahrgangs. Dies lässt sich auch gut aus der abschließenden Reflexion herauslesen:




